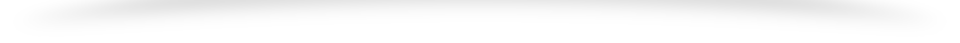Der Titel „Abyss – The Final Chapter“ weckt Erwartungen, die das Album letztlich nicht erfüllt. Statt eines finalen Kapitels präsentiert die Band eine Zusammenführung der bereits 2023 und 2025 veröffentlichten EPs „Abyss Pt.1“ und „Abyss Pt.2“, ergänzt um lediglich drei neue Songs, die zwischen die bekannten Stücke eingeflochten werden. Von einem echten Abschluss oder einer dramaturgischen Vollendung kann daher keine Rede sein. Vielmehr wirkt die Veröffentlichung wie eine geschickt verpackte Fast-Mogelpackung, die den Zyklus verlängert, ohne ihn wirklich zu beschließen. Musikalisch setzen ANNISOKAY auf „Abyss“ auf eine härtere, düsterere Ausrichtung ihres MetalCore, die für die Band durchaus eine Entwicklung darstellt. Doch abstrahiert man von der Eigenwahrnehmung, bleibt festzuhalten: Die Hallenser liefern solide Genre-Kost, die man in den vergangenen Jahren vielfach gehört hat. Es geht hier nicht um die Wiederveröffentlichung bekannten Materials, sondern um die Tatsache, dass die Band auf vertrauten Pfaden ihres Genres wandelt. Das Quartett kombiniert elektronische Elemente mit einem bombastischen Sound-Design, das in seiner Präzision fast schon steril wirkt. Die Produktion ist makellos, kalkuliert und perfekt ausbalanciert – ein technisches Meisterstück, das jedoch die Gefahr birgt, emotionale Tiefe zu verlieren. Nicht jeder Hörer wird hier abgeholt, denn die glatte Oberfläche lässt wenig Raum für Spontaneität oder echte Überraschungen. Die typischen Hart-Zart-Kontraste, aggressive Shouts im Wechsel mit melodischen Refrains, sind handwerklich sauber umgesetzt, aber eben auch altbekannt. ANNISOKAY beschränken sich auf eingeführtes Core-Terrain, ohne es entscheidend weiterzudenken. Sicherlich: Kompositorisch, spielerisch und produktionstechnisch bewegt sich die Band auf hohem Niveau. Doch „Abyss – The Final Chapter“ bleibt den entscheidenden Aha-Moment schuldig. Besonders auffällig ist die immer wieder überspitzte Betonung der poppigen Ausrichtung. Statt als Brücke zwischen Härte und Eingängigkeit zu wirken, verstärkt sie den Eindruck einer kalkulierten Inszenierung. Die Songs sind darauf ausgelegt, zwischen Streaming-Playlist und Festival-Bühne möglichst breit zu funktionieren, verlieren dabei aber an Kontur und Eigenständigkeit.
Der Titel „Abyss – The Final Chapter“ weckt Erwartungen, die das Album letztlich nicht erfüllt. Statt eines finalen Kapitels präsentiert die Band eine Zusammenführung der bereits 2023 und 2025 veröffentlichten EPs „Abyss Pt.1“ und „Abyss Pt.2“, ergänzt um lediglich drei neue Songs, die zwischen die bekannten Stücke eingeflochten werden. Von einem echten Abschluss oder einer dramaturgischen Vollendung kann daher keine Rede sein. Vielmehr wirkt die Veröffentlichung wie eine geschickt verpackte Fast-Mogelpackung, die den Zyklus verlängert, ohne ihn wirklich zu beschließen. Musikalisch setzen ANNISOKAY auf „Abyss“ auf eine härtere, düsterere Ausrichtung ihres MetalCore, die für die Band durchaus eine Entwicklung darstellt. Doch abstrahiert man von der Eigenwahrnehmung, bleibt festzuhalten: Die Hallenser liefern solide Genre-Kost, die man in den vergangenen Jahren vielfach gehört hat. Es geht hier nicht um die Wiederveröffentlichung bekannten Materials, sondern um die Tatsache, dass die Band auf vertrauten Pfaden ihres Genres wandelt. Das Quartett kombiniert elektronische Elemente mit einem bombastischen Sound-Design, das in seiner Präzision fast schon steril wirkt. Die Produktion ist makellos, kalkuliert und perfekt ausbalanciert – ein technisches Meisterstück, das jedoch die Gefahr birgt, emotionale Tiefe zu verlieren. Nicht jeder Hörer wird hier abgeholt, denn die glatte Oberfläche lässt wenig Raum für Spontaneität oder echte Überraschungen. Die typischen Hart-Zart-Kontraste, aggressive Shouts im Wechsel mit melodischen Refrains, sind handwerklich sauber umgesetzt, aber eben auch altbekannt. ANNISOKAY beschränken sich auf eingeführtes Core-Terrain, ohne es entscheidend weiterzudenken. Sicherlich: Kompositorisch, spielerisch und produktionstechnisch bewegt sich die Band auf hohem Niveau. Doch „Abyss – The Final Chapter“ bleibt den entscheidenden Aha-Moment schuldig. Besonders auffällig ist die immer wieder überspitzte Betonung der poppigen Ausrichtung. Statt als Brücke zwischen Härte und Eingängigkeit zu wirken, verstärkt sie den Eindruck einer kalkulierten Inszenierung. Die Songs sind darauf ausgelegt, zwischen Streaming-Playlist und Festival-Bühne möglichst breit zu funktionieren, verlieren dabei aber an Kontur und Eigenständigkeit.
(Arising Empire)